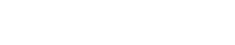Hochschulkolloquium
New Work und mentale Gesundheit: Beitrag der Psychologie
Mit Nicole Kopp MSc & Prof. Dr. Andreas Krause
| Veranstaltungsart | Kolloquium |
| Inhalt | Der Impulsbeitrag der renommierten Beraterin und Arbeits- und Organisationspsychologin Nicole Kopp beleuchtet, wie die Psychologie zur Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen im Kontext von New Work beiträgt. New Work, als Konzept flexibler und selbstbestimmter Arbeitsformen, birgt sowohl Potenziale als auch Herausforderungen für die mentale Gesundheit. Nicole Kopp verzahnt ihre Erfahrungen mit dem Stand der Forschung und zeigt u.a. auf, wie psychologisches Wissen sowohl individuelle Resilienz fördert als auch die organisatorische Struktur stärkt – aber auch, welche dunklen Seiten mit der unreflektierten Einführung von New Work verbunden sein können. |
| Wann | 15. Oktober 2025 13.15 – 14.45 Uhr |
| Wo | Aula im OVR, Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten Lageplan |
Nachlese
Im Rahmen des diesjährigen Hochschulkolloquiums der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW gaben Nicole Kopp, Arbeits- und Organisationspsychologin sowie Gründerin von GoBeyond, und Prof. Dr. Andreas Krause einen vielschichtigen Einblick in die psychologischen Dimensionen von New Work und deren Auswirkungen auf die mentale Gesundheit.
Nicole Kopp eröffnete ihren Impuls mit einer kritischen Reflexion über den Begriff „New Work“, den sie als Container-Konzept beschrieb – ein Begriff, der von vielen unterschiedlich interpretiert wird und oft als Projektionsfläche für individuelle Bedürfnisse dient. Ursprünglich von Frithjof Bergmann als „Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen“ definiert, steht New Work heute für flexible, selbstbestimmte und sinnstiftende Arbeitsformen. Die aktuelle FlexWork Trendstudie 2024 zeigt, dass rund die Hälfte der Schweizer Erwerbstätigen zumindest gelegentlich mobil arbeitet und etwa ein Drittel bereits Praktiken wie Kanban oder Scrum nutzt. Diese neuen Arbeitsformen gehen mit einem erhöhten Empowerment-Erleben und einer besseren Life-Domain-Balance einher – allerdings nicht für alle gleich. Damit zeigt Kopp auf, dass mentale Gesundheit und New Work eng miteinander verbundene Themenfelder sind, die sie in der Praxis oft antrifft.
Kopp betonte, dass mentale Gesundheit kein binäres Konzept sei, sondern ein Spektrum. Der AXA Mind Health Report 2025 unterstreicht diese Sichtweise: Nur 25 % der Befragten weltweit befinden sich im Zustand des „Flourishing“, während 43 % der jungen Erwachsenen (18–34 Jahre) potenziell von Depressionen, Angst oder Stress betroffen sind. Die Frage „Wie geht es dir wirklich?“ wird im Arbeitskontext noch zu selten gestellt – laut Studien haben 6 von 10 Berufstätigen noch nie über ihre mentale Gesundheit am Arbeitsplatz gesprochen. Die CSS Gesundheitsstudie 2024 ergänzt, dass etwa ein Drittel der Befragten aus Angst vor Diskriminierung psychische Belastungen am Arbeitsplatz verschweigt.
Kopp stellte drei zentrale Hebel für gesunde Arbeit vor: den Umgang mit Emotionen, das Äussern von Bedürfnissen und die Gestaltung der Zusammenarbeit. Emotionen seien laut Antonio Damasio keine Störfaktoren, sondern essenziell für Entscheidungen – wir sind „Emotionsmaschinen, die denken können“. In ihrer Beratungspraxis nutzt Kopp Werkzeuge wie den „Mood Meter“ oder achtsame Check-ins, um emotionale Zustände sichtbar zu machen und die psychologische Sicherheit im Team zu stärken. Studien zeigen, dass das Benennen von Emotionen die Aktivität der Amygdala senkt und die kognitive Kontrolle verbessert.
Beim Thema Bedürfnisse plädierte Kopp für mehr Transparenz: Was braucht ein Mensch, um gute Arbeit zu leisten? Ihr Vorschlag eines „Benutzerhandbuchs zu sich selbst“ – mit Fragen zu bevorzugter Kommunikation, Stressanzeichen und Unterstützungswünschen – stiess auf grosses Interesse. In Workshops werden diese Handbücher im Team geteilt und reflektiert, was zu mehr gegenseitigem Verständnis und besserer Zusammenarbeit führt.
Die dritte Säule widmete sich der Arbeitsorganisation. Diese Fragmentierung des Arbeitstags führt zu einem „Infinite Workday“, der kaum Raum für fokussiertes Arbeiten lässt. Kopp empfiehlt daher Fokuszeiten, klare Kommunikationsregeln und eine „Smartwork-Charta“, um Erwartungen und Kanäle im Team zu definieren.
Prof. Dr. Andreas Krause ergänzte den Impuls mit aktuellen Forschungsergebnissen zu neuen Formen der Zusammenarbeit wie Holacracy, Shared Leadership und agilen Methoden. Er zeigte auf, dass agile Arbeitspraktiken mit deutlich mehr Ressourcen wie Autonomie und Peer Support einhergehen, was wiederum das Engagement der Mitarbeitenden stärkt. Tendenziell wird auch Stress reduziert, gleichzeitig entstehen jedoch neue Anforderungen, etwa durch erhöhte Selbstverantwortung oder unklare Rollen. Bemerkenswert ist, dass die meisten Studien in Organisationen durchgeführt wurden, die weiterhin auch auf traditionelle Hierarchien setzen. Selbst unter diesen Bedingungen überwiegen für Mitarbeitende die gesundheitlichen Chancen die potenziellen Risiken.
Das Kolloquium machte deutlich: Die Psychologie bietet wertvolle Werkzeuge, um New Work gesund zu gestalten – vorausgesetzt, sie wird reflektiert und kontextsensibel angewendet. Emotionale Intelligenz, Bedürfnisorientierung und eine bewusste Gestaltung der Zusammenarbeit sind zentrale Erfolgsfaktoren. Gleichzeitig braucht es mehr Forschung zu den langfristigen Auswirkungen neuer Arbeitsformen auf die mentale Gesundheit. Ein inspirierender Nachmittag, der viele Impulse für Praxis, Forschung und persönliche Reflexion lieferte.